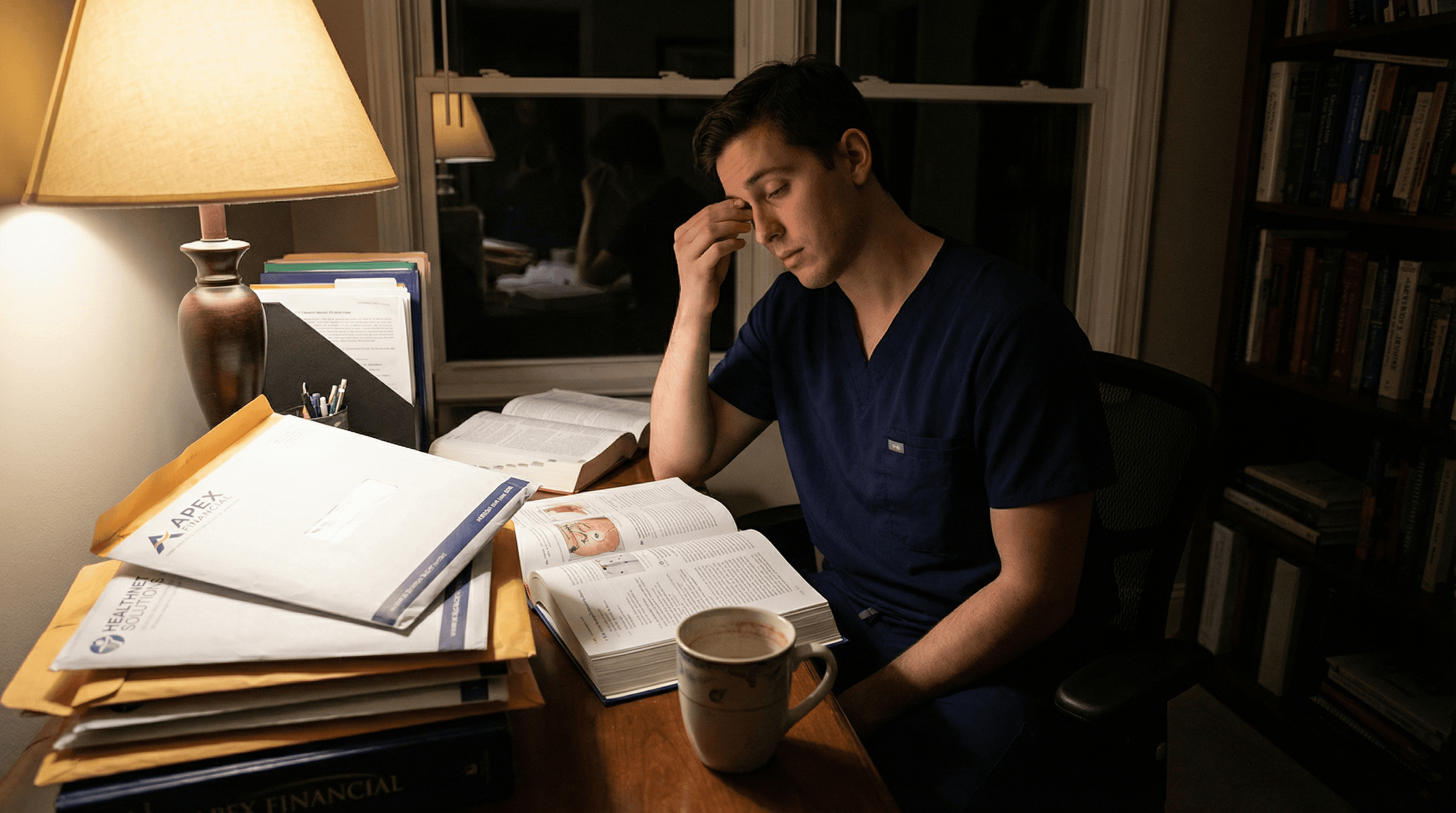Praxis
Finanzskalpell® Ärzte Honorar Report Praxis 2025
Lesedauer: 17 Minuten
23.05.2025
Zusammenfassung
Die Honorare und Gehälter niedergelassener Ärztinnen und Ärzte in Deutschland haben sich in den letzten Jahren uneinheitlich entwickelt. Nach einem pandemiebedingten Hoch im Jahr 2021 wuchsen die Einkommen 2022 nur noch geringfügig – inflationsbereinigt ergab sich sogar ein Rückgang .
Für 2023 und 2024 stehen Praxen vor besonderen Herausforderungen: Steigende Praxiskosten (Personal, Energie, Material) treffen auf nur moderate Honorarzuwächse. Dennoch gibt es erhebliche Unterschiede je nach Fachrichtung, Beschäftigungsart und Region.
Dieser Report liefert einen fundierten Überblick über die Honorarentwicklung 2023–2025, gestützt auf aktuelle Daten aus Quellen wie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), dem Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi), Berufsverbänden und statistischen Ämtern.
Zudem werden die wichtigsten Einflussfaktoren – von Inflation über GOÄ-/EBM-Anpassungen bis hin zum Privatpatientenanteil – beleuchtet und mittels Tabellen veranschaulicht. Ziel ist es, niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sowie angehenden PraxisgründerInnen ein klares Bild der wirtschaftlichen Lage zu vermitteln.
Honorarentwicklung 2020 bis 2025: Auf und Ab in herausfordernden Zeiten
Die gesamten Honorareinnahmen und Überschüsse niedergelassener Ärzteschaft stiegen zwischen 2019 und 2021 zunächst deutlich an, flachten 2022 jedoch ab. Laut Zi-Praxis-Panel lag der durchschnittliche Jahresüberschuss je Praxisinhaber/in 2022 bei rund 190.400 €, nach 187.000 € im Vorjahr . Nominal ein Plus von 1,8 %, aber angesichts einer allgemeinen Teuerungsrate von ~7 % ein spürbarer Kaufkraftverlust. Die Sondereffekte der COVID-19-Pandemie sind klar erkennbar: 2021 erzielten viele Praxen durch Nachholeffekte und Impfkampagnen außergewöhnlich hohe Überschüsse . 2022 hingegen stiegen die Einnahmen nur minimal, während die Praxisausgaben stark kletterten (u. a. durch Inflation bei Personal- und Sachkosten), sodass der Überschuss real sank .
Diese Tendenz setzte sich Anfang 2023 fort. Beispielsweise sanken im ersten Halbjahr 2023 die GKV-Honorarumsätze der Hausärzte gegenüber dem Vorjahr um 1,2 % (minus 82 Mio. €) . Hauptgrund war die Streichung der Neupatientenregelung aus dem TSVG, die bis 2022 zusätzliche extrabudgetäre Vergütungen ermöglicht hatte. Entsprechend ging die Auszahlungsquote (Anteil der voll vergüteten Leistungen) für Hausärzte bundesweit von 99,4 % auf 98,8 % zurück . Positiv anzumerken ist, dass die Fallzahlen sogar stärker sanken (-4,4 %), sodass der durchschnittliche Erlös pro Behandlungsfall leicht stieg (+3,3 %) – ein Hinweis darauf, dass Praxen 2023 etwas weniger Patienten behandelten, aber dabei komplexere Leistungen abrechneten.
Demgegenüber konnten einzelne Fachgruppen 2023 Zuwächse verbuchen. Besonders deutlich war dies bei den Kinder- und Jugendärzten: Seit dem 2. Quartal 2023 werden alle Leistungen der Pädiatrie extrabudgetär vergütet, was in vielen KVen zu merklichen Honorarsteigerungen führte . Laut KBV-Honorarbericht stieg der quartalsbezogene Umsatz je Kinderarzt in einigen Regionen zweistellig, nachdem zuvor Budgets die Vergütung gedeckelt hatten. Dieser Schritt war eine politische Reaktion auf die Versorgungskrise in der Kinderheilkunde und zeigt, wie Regeländerungen die Honorare beeinflussen können.
Insgesamt blicken viele niedergelassene Ärzte jedoch etwas sorgenvoll in die Zukunft . Zwar brachte die Honorarverhandlung für 2024 nominell +3,85 % höhere Vergütungen (etwa 1,6 Mrd. € mehr) , doch Berufsverbände kritisieren dies scharf. Angesichts weiterhin hoher Kosten bezeichnete man das Ergebnis als „faktische Nullrunde“ – einige sprachen gar von einem „Frühverrentungsprogramm für Praxisärzte“ . Die Diskrepanz zwischen Kostenentwicklung und Honoraranpassung ist tatsächlich eklatant: Zwischen 2015 und 2024 stiegen die Praxiskosten um rund 38 %, der GKV-Orientierungswert (Punktwert) aber nur um 17,6 % . Mit anderen Worten: Viele Praxen müssen immer mehr erwirtschaften, um real auf dem gleichen Einkommensniveau zu bleiben. 2025 steht nun die nächste Anpassung an – die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) konnte im September 2024 zwar erneut 3,85 % Honorarzuwachs durchsetzen, aber ob dies die Inflation der Jahre 2023/24 ausgleicht, bleibt fraglich.
Tipp: Gerade Praxisgründer sollten die Trends der letzten Jahre berücksichtigen. Ein Blick auf betriebswirtschaftliche Kennzahlen der Praxis (Einnahmenstruktur, Kostenquote, Überschussentwicklung) im Vergleich zum Bundesdurchschnitt kann helfen, realistische Gewinnerwartungen zu setzen. Die Daten des Zi-Praxis-Panels oder der KBV-Honorarberichte bieten hierfür eine Orientierung .
Arzthonorar Tabelle: Facharztgruppen im Vergleich
Die Einkünfte niedergelassener Ärzte unterscheiden sich stark nach Fachrichtung. Allgemein gilt: Technisch-investitionsintensive Fächer mit höherem Privatpatientenanteil erzielen meist höhere Überschüsse als grundversorgende Fächer. Im Folgenden ein Überblick über ausgewählte Facharztgruppen und ihre durchschnittlichen Jahresüberschüsse (Nettoeinkünfte aus der Praxis) auf Basis von Zi-Daten für 2022:
Fachgebiet (Praxis) | Ø Jahresüberschuss 2022 pro Inhaber*in |
|---|---|
Allgemeinmedizin/Innere Medizin (HA) | ca. 236 Tsd. € (+26 % seit 2019) |
Kinder- und Jugendmedizin | ca. 231 Tsd. € (+16 % seit 2019) |
Gynäkologie (Frauenheilkunde) | ca. 180 Tsd. € |
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde (HNO) | ca. 207 Tsd. € |
Dermatologie (Hautarzt) | ca. 237 Tsd. € (Schätzung, konservativ tätige Hautärzte ~191 T€, operativ tätige ~387 T€) |
Orthopädie/Unfallchirurgie | ca. 213 Tsd. € |
Augenheilkunde (Ophthalmologie) | ca. 299 Tsd. € |
Urologie | ca. 302 Tsd. € |
Psychotherapie (durch Ärzte) | ~150 Tsd. € (Schätzung, tendenziell niedrigstes Ärzte-Einkommen) |
Erläuterung: Die Werte sind Durchschnittswerte pro Arzt und Jahr. Sie basieren auf dem Jahresüberschuss (Praxisgewinn vor Steuern, nach Abzug aller Praxiskosten). Insbesondere bei operativen/technischen Fächern besteht eine große Spreizung zwischen eher konservativ tätigen Kollegen und solchen mit hohem Anteil an selbst erbrachten Operationen oder technischen Leistungen.
So verdienen etwa operativ tätige Dermatologen im Schnitt deutlich mehr als rein konservativ arbeitende Dermatologen . Ähnlich verhält es sich bei Augenärzten, Chirurgen und Urologen, wo OP-Leistungen den Gewinn steigern können. Radiologen, Nuklearmediziner und Strahlentherapeuten (hier nicht aufgeführt) gehören typischerweise zu den Spitzenverdienern, allerdings sind deren Daten schwer vergleichbar, da sie oft in Apparategemeinschaften oder MVZs arbeiten und extrem hohe Umsätze ebenso wie Kosten haben. Laut Zi liegen in diesen Fächern die Durchschnittsüberschüsse rund 80 % über dem Median – einige sehr umsatzstarke Praxen ziehen den Schnitt nach oben.
Honorar Hausärzte vs. Fachärzte
Wie die obige Tabelle zeigt, lag das durchschnittliche Nettoeinkommen eines Hausarztes 2022 mit ca. 236.000 € etwa auf dem Niveau vieler Fachärzte. In der Mittelfeld-Gruppe (um 200–240 Tsd. €) befinden sich u.a. Allgemeinmediziner, Kinderärzte, Dermatologen, HNO-Ärzte, Orthopäden und Internisten (fachärztlich). Deutlich darunter – meist unter 150.000 € – liegen typischerweise psychologische Psychotherapeuten sowie einige Arztgruppen mit begrenztem Leistungsspektrum (z. B. Arbeitsmedizin oder Öffentlicher Gesundheitsdienst), die hier aber eine untergeordnete Rolle spielen. Am oberen Ende der Skala rangieren die technischen Fächer: Radiologie, Augenheilkunde, Urologie, ggf. auch Labormedizin – hier sind Überschüsse um 300.000 € und mehr keine Seltenheit . Allerdings erkaufen sich diese Fächer ihr hohes Einkommen oft durch höhere Investitionen und Personalaufwand. So haben Radiologie-Praxen beträchtliche Gerätekosten, und Ophthalmologen oder Chirurgen benötigen für OP-Leistungen mehr Personal und Material.
Ein interessanter Aspekt ist die Entwicklung über die Jahre: Hausärzte und grundversorgende Fachärzte konnten ihre Überschüsse 2019–2022 um ca. 15–25 % steigern, teils dank extrabudgetärer Vergütungen (TSVG-Regelungen) und Corona-Sondereffekten . Dagegen fiel das Wachstum in einigen Spezialfächern geringer aus – etwa Orthopäden und Psychiater verzeichneten mit ~2 % pro Jahr die niedrigsten Zuwachsraten . Insgesamt bleibt festzuhalten, dass nahezu alle Gruppen 2022 einen realen Einbruch hinnehmen mussten, da die Inflation die nominalen Zuwächse überstieg. Für 2023/24 sind die Daten teils noch ausstehend; es deutet sich aber an, dass z.B. Hausärzte stagnierende bis leicht sinkende Honorare (GKV-seitig) haben , während Kinderärzte einen kräftigen Sprung nach oben gemacht haben. Die Schere zwischen verschiedenen Fachgruppen könnte sich also weiter geöffnet haben.
Hinweis: Die Zahlen für Überschüsse sind Durchschnittswerte. In der Realität variieren die Einkommen innerhalb jeder Fachgruppe enorm. Faktoren wie Praxisgröße, Leistungsumfang, Privatpatientenquote und regionale Kaufkraft beeinflussen den Gewinn. Beispielsweise liegt laut Zi-Praxis-Panel bei Hausärzten das obere Quartil der Jahresüberschüsse über 280.000 €, während das untere Quartil unter 211.000 € liegt . Bei Augenärzten oder Radiologen sind die Spannweiten noch größer – hier erwirtschaften einzelne Praxen weit über 500.000 € Überschuss, während andere (z.B. in strukturschwachen Gebieten) deutlich darunter liegen können.
Niedergelassen (selbstständig) vs. angestellt: Ein Gehaltsvergleich
Neben der Fachrichtung beeinflusst der Berufsstatus das Einkommen erheblich. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte tragen zwar das Unternehmerrisiko, erzielen im Schnitt aber ein deutlich höheres Einkommen als ihre angestellten Kolleg*innen. Dies zeigt sich besonders im ambulanten Bereich, wo mittlerweile viele Ärzte als Angestellte in Praxen oder MVZ (Medizinischen Versorgungszentren) tätig sind.
Eine aktuelle Befragung von 700 angestellten Ärzten durch die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (Apobank) liefert folgende Richtwerte :
Angestellte Hausärzte in Praxen: durchschnittlich 75.900 € brutto jährlich (Median ca. 60.000–88.000 €).
Angestellte Fachärzte in Praxen: durchschnittlich 87.600 € brutto jährlich (ca. 15 % mehr als Hausärzte; Median 65.000–102.600 €) .
Zum Vergleich: Die oben genannten 236.000 € Jahresüberschuss für selbstständige Hausärzte entsprechen einem Bruttoeinkommen in ähnlicher Höhe (da es vor Steuern ist). Hier wird der Unterschied klar: Ein niedergelassener Hausarzt erwirtschaftet im Schnitt etwa das Dreifache dessen, was ein angestellter Hausarzt als Gehalt bezieht. Bei Fachärzten ist die Relation ähnlich – z.B. Urologen mit ~300.000 € Praxisgewinn vs. ~88.000 € als Angestelltengehalt.
Woran liegt das? Zum einen müssen Angestellte keinen Praxisbetrieb finanzieren – ihre Arbeitgeber (die Praxisinhaber oder MVZ-Träger) tragen die Kosten und Risiken. Ein großer Teil der Honorare fließt also an die Praxis selbst, nicht an das Gehalt. Zum anderen sind viele Angestelltenstellen in Teilzeit oder haben gedeckelte Bonusmodelle. Laut der Apobank-Studie erhalten nur 23 % der Angestellten in Arztpraxen umsatzabhängige Boni, während es bei MVZ-Angestellten 36 % sind .
MVZ vs. klassische Praxis
Interessanterweise zahlen MVZ im Durchschnitt höhere Gehälter. Angestellte Ärzte im MVZ verdienen etwa 16.500 € mehr pro Jahr als Angestellte in einer einzelnen Praxis . So lag das durchschnittliche Festgehalt für Hausärzte im MVZ bei ~92.400 € vs. 75.900 € in Praxen, für Fachärzte entsprechend höher (~104.000 € vs. 87.600 €). MVZ können aufgrund ihrer Größe und Trägerschaft (teils investorengeführt oder kommunal) oft bessere Konditionen bieten und nutzen Boni häufiger als Anreiz .
Krankenhausärzte
In diesem Report liegt der Fokus auf dem ambulanten Sektor, doch zum Einordnen sei erwähnt: Klinikärzte haben Tarifverträge mit gestaffelten Gehältern nach Position und Erfahrung. Eine Fachärztin mit 5 Jahren Erfahrung verdient im Krankenhaus (TV-Ärzte, Stufe 4) etwa 6.415 € brutto monatlich (~77.000 € jährlich) , in höheren Stufen bzw. als Oberärzt*in deutlich mehr (Stufe Oberarzt ~100.000 €). Mehr dazu hier.
Chefärztinnen und Chefärzte können durch Zuschläge und Privatliquidation sehr hohe Einkommen erzielen, sind aber eine kleine Gruppe. Für junge Ärzte in Weiterbildung liegen die Tarifgehälter anfangs bei ~60.000 € jährlich. Somit bewegen sich die durchschnittlichen Klinikgehälter in einer ähnlichen Größenordnung wie die oben genannten Gehälter angestellter Praxisärzte (häufig zwischen 60–100.000 € brutto). Die großen Gehaltssprünge finden im ambulanten Bereich fast ausschließlich in der Selbständigkeit statt.
Warum wählen dennoch viele die Anstellung
Entscheidend sind nicht nur Zahlen. Arbeitszeit und Work-Life-Balance spielen eine Rolle. Eine Assistenzärztin formulierte treffend: „Wenn ich in Teilzeit schon 40 Stunden die Woche arbeite, warum sollte ich mir eine Vollzeit-Niederlassung mit 60+ Stunden antun?“ . Die Selbständigkeit bedeutet neben höherem Verdienst eben auch Verantwortung für Personal, Bürokratie und unternehmerisches Risiko.
In Umfragen geben viele junge Ärztinnen und Ärzte an, dass ihnen geregelte Arbeitszeiten und Planbarkeit wichtiger sind als ein maximales Einkommen. Zudem schrecken Investitionskosten (Praxisübernahme, Geräte) und Unsicherheiten über die Honorarentwicklung manchen Nachwuchs ab . Die Folge: Immer weniger Absolventen entscheiden sich direkt für die Niederlassung, viele bevorzugen zunächst eine Anstellung. Dieser Trend ist in der hausärztlichen Versorgung besonders ausgeprägt, sodass KVen teils finanzielle Förderungen anbieten, um Niederlassungen schmackhaft zu machen.
Insgesamt gilt: Selbständige Ärztinnen und Ärzte verdienen mehr, müssen dafür aber auch mehr leisten (im doppelten Sinne). Jede(r) Mediziner/in muss abwägen, welcher Karrierepfad individuell passt. Finanzielle Aspekte sind wichtig – so sollte man z.B. wissen, dass ein Umsatz von 300.000 € in der eigenen Praxis keineswegs „viel zu viel“ ist, da davon Angestellte, Miete, Geräte etc. bezahlt werden müssen.
Am Ende bleibt davon (je nach Fach) nur ein bestimmter Prozentsatz als persönliches Einkommen übrig. Genau dieser Praxisüberschuss liegt in den genannten Größenordnungen und ist die „Entlohnung“ für das unternehmerische Risiko. Wer dieses Risiko scheut, erhält als Angestellter zwar weniger vom Kuchen, dafür aber ein fixes Gehalt und meist etwas mehr Freizeit.
Regionale Unterschiede: Wo verdienen Ärzte am meisten?
Nicht nur wie, sondern auch wo ein Arzt arbeitet, hat Einfluss auf das Honorar. Regionale Unterschiede zeigen sich sowohl zwischen Bundesländern als auch zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. Allerdings fallen diese Unterschiede im ambulanten Bereich weniger drastisch aus als man vielleicht vermuten würde – der Sicherstellungsauftrag und die Honorarverteilung durch die KVen sorgen für einen gewissen Ausgleich. Dennoch lohnt der Blick auf Details:
Ost vs. West (und Süd)
In den neuen Bundesländern ist der Anteil privat versicherter Patienten deutlich geringer als in Westdeutschland. Dies wirkt sich auf die Gesamteinnahmen aus, da Privatpatienten erfahrungsgemäß höhere Erlöse pro Leistung bringen. Gleichzeitig bestehen in manchen ostdeutschen Regionen Hausarztmangel und längere Anfahrtswege, was oft zu höheren GKV-Fallzahlen pro Arzt führt.
Ein Vergleich: Ein Hausarzt in Sachsen-Anhalt erzielte im 1. Halbjahr 2023 pro Quartal durchschnittlich rund 78.943 € Honorarumsatz aus der GKV bei 1.063 Behandlungsfällen . In Baden-Württemberg waren es dagegen nur 52.865 € bei 687 Fällen . Die ostdeutschen Hausärzte behandeln also im Schnitt erheblich mehr Patienten, wodurch ihre GKV-Umsätze je Arzt höher ausfallen können. Allerdings liegt der Fallwert (Erlös pro Fall) in Sachsen-Anhalt niedriger (hier ca. 74 € vs. 77 € in Baden-Württemberg) , was an der geringeren Privat- und Selbstzahlerquote liegt.
Westdeutsche und süddeutsche Praxen kompensieren den kleineren GKV-Umsatz nämlich oft durch Privatliquidation. Beispielsweise kommen Hausärzte in Berlin im Quartal zwar auf nur ~58.000 € Kassenumsatz, haben aber im Schnitt einen höheren Anteil Privatpatienten, was ihren Gesamtumsatz steigert . Summa summarum lagen in der Vergangenheit die Gesamteinkommen (GKV + privat) der Ärzte in wohlhabenderen westlichen Bundesländern leicht über denen im Osten.
Stadt vs. Land
Interessanterweise verdienen angestellte Hausärzte auf dem Land im Schnitt etwas mehr als in der Stadt. In Gemeinden <20.000 Einwohner lag das Durchschnittsbrutto eines angestellten Hausarztes bei 78.200 €, in Großstädten bei 74.900 € . Der Grund: In ländlichen Regionen müssen Arbeitgeber teils höher zahlen, um Ärzte zu gewinnen, und die Verantwortung in unterversorgten Gebieten ist hoch (Stichwort „Landarztquote“ als Anreizprogramm).
Bei angestellten Fachärzten zeigte sich laut der Apobank-Studie hingegen ein leicht höheres Gehalt in der Stadt gegenüber dem Land – vermutlich weil spezialisierte Tätigkeiten (z.B. in MVZ) häufiger in urbanen Zentren angesiedelt sind. Für Selbständige gilt: Auf dem Land haben Ärzte oft weniger Konkurrenz und vollere Wartezimmer, was hohe Fallzahlen und Umsätze bringen kann. Andererseits ist das Privatpatientenaufkommen in strukturarmen Gegenden gering. Viele Landärzte profitieren jedoch von Förderungen (z.B. Investitionskostenzuschüsse durch KVen oder Länder). Insgesamt halten sich Vor- und Nachteile die Waage, sodass man nicht pauschal sagen kann, dass Landärzte weniger verdienen.
Ein Blick auf konkrete Bundesländer zeigt moderate Unterschiede. Laut KBV-Daten (GKV-Abrechnung 2023) lagen die Hausarzt-Honorare (GKV) in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern an der Spitze – hier über 74.000 € pro Quartal . Hamburg, Berlin und Baden-Württemberg bildeten das Schlusslicht mit teils unter 60.000 € . Zieht man jedoch die Privatumsätze hinzu, verschiebt sich das Bild etwas: In Hamburg oder München mit hohem Privatversicherten-Anteil erzielen viele Fachärzte gesamt höhere Einnahmen als in ostdeutschen Regionen, trotz niedrigerer GKV-Zahlen.
Nord vs. Süd
Es gibt Hinweise, dass in süddeutschen Bundesländern (Bayern, BaWü) die Gesamteinkommen niedergelassener Ärzte im Schnitt am höchsten sind – begünstigt durch zahlungskräftige Patienten und hohe Privatversichertenzahlen. Statistiken des Statistischen Bundesamts von früheren Jahren zeigten z.B., dass der Reinertrag einer Arztpraxis in Bayern deutlich über dem Bundesschnitt lag. In Norddeutschland (Schleswig-Holstein, Niedersachsen) und Westfalen wiederum sind die GKV-Punktwerte leicht besser (durch regionale Morbiditätsstrukturen), was den Kassenumsatz hebt. Diese Effekte sind jedoch relativ gering.
Zusammengefasst: Regionale Honorarunterschiede existieren, aber kein Faktor allein (Ost/West, Stadt/Land) entscheidet über „gutes“ oder „schlechtes“ Einkommen. Oft kompensieren sich Gegensätze: Weniger Privatpatienten in Ost/Land werden durch höhere Fallzahlen oder Zuschläge ausgeglichen, während im West/Stadt-Bereich weniger Patienten pro Arzt durch höheren Pro-Kopf-Umsatz aufgefangen werden. Für angehende Niedergelassene lohnt es sich dennoch, die regionale Bedarfssituation zu analysieren. Eine Praxis in unterversorgter Region kann finanziell attraktiv sein (volle Auslastung, ggf. Fördermittel), während in saturierten städtischen Gebieten der Wettbewerb um zahlende Patienten größer ist.
Fazit: Wähle den Praxisstandort nicht allein nach dem zu erwartenden Honorar. Faktoren wie Lebensqualität, Infrastruktur, Schulangebot (für eigene Kinder) und persönliche Vorlieben sind ebenso wichtig. Die Honorarunterschiede sind zwar real, aber in vielen Fällen weniger gravierend als angenommen – engagierte Ärztinnen und Ärzte können sowohl in der Stadt als auch auf dem Land wirtschaftlich erfolgreich praktizieren.
Aktuelle Einflussfaktoren 2023–2025: Inflation, Personal, GOÄ & Co.
Die wirtschaftliche Situation von Arztpraxen wird derzeit von mehreren Megatrends geprägt, die die Honorar- und Gehaltsentwicklung beeinflussen:
Hohe Inflation und Praxiskosten
Die Jahre 2022 und 2023 brachten die höchste Inflation seit Jahrzehnten (zwischen 6 % und 8 %). Dies schlug direkt auf Praxen durch: Energiekosten stiegen (Heizung, Strom für Geräte), ebenso Materialkosten (Schutzausrüstung, Medizinprodukte) und vor allem Personalkosten.
Medizinische Fachangestellte (MFA) fordern zurecht höhere Löhne; viele Praxen erhöhten Gehälter spürbar, um Mitarbeiter zu halten. Laut KBV mussten 2022 die Aufwendungen der Praxen um über 10 % steigen, um die Inflation zu bewältigen . 2023 setzte sich dieser Trend fort. Zwar wird in den Honorarverhandlungen versucht, diese Kosten zu berücksichtigen – der Orientierungswert 2024 wurde formal um 3,85 % erhöht, wobei erstmals ein Mechanismus etabliert wurde, zukünftige MFA-Tariferhöhungen schneller zu berücksichtigen.
Doch in der Wahrnehmung vieler Ärztinnen und Ärzte reicht das nicht aus: Die Kosten seien ihnen davon gelaufen, während die Vergütungsschritte zu klein seien. Einige Praxisinhaber berichten, dass ihr Überschuss 2023 real um 5–10 % gesunken ist, weil etwa Energiekostenzuschläge ausliefen und gleichzeitig die Inflation noch nicht voll kompensiert wurde. Es bleibt zu hoffen, dass die zuletzt sinkenden Inflationsraten 2024 etwas Luft verschaffen.
EBM-Anpassungen und Budgetierung
Veränderungen im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) und der Budgetsystematik wirken sich unmittelbar aus. Eine wichtige Änderung war Anfang 2023 das Ende der Neupatientenregelung (TSVG) – dies bedeutete für viele Haus- und Fachärzte einen Wegfall extrabudgetärer Vergütungsanteile, was entsprechend Honorar gekostet hat . Auf der anderen Seite wurde Mitte 2023 entschieden, Kinderärzte von Budgets zu befreien (Entbudgetierung Kapitel 4 EBM). Ergebnis: Kinderärzte können seither alle Leistungen voll bezahlt abrechnen, was ihr Honorarvolumen deutlich steigerte . Ähnliche Forderungen werden von anderen Fachgruppen gestellt (z.B. Laborärzte, Radiologen), stoßen aber auf Widerstand der Krankenkassen.
Generell mehren sich die Rufe nach Entbudgetierung, da viele Ärztinnen und Ärzte es als ungerecht empfinden, erbrachte Leistungen nur teilweise vergütet zu bekommen. Die Politik hat hierzu noch keine grundsätzliche Kehrtwende vollzogen – es bleibt also vorerst bei punktuellen Anpassungen. Im Jahr 2024 wurde zumindest erreicht, dass bei steigenden Akutfallzahlen (z.B. Grippewelle) eine Nachvergütung erfolgen muss, um Budgetverluste abzumildern .
Orientierungswert und Honorarverhandlungen
Der Orientierungswert (Centwert je Punkt im EBM) ist das zentrale Stellrad für GKV-Honorare. Hier prallten 2023 die Fronten aufeinander: Der GKV-Spitzenverband forderte zunächst sogar eine Nullrunde 2024 für Ärzte , während die KBV aufgrund der Kostenexplosion >10 % mehr verlangte (inklusive expliziter Berücksichtigung von MFA-Gehältern). Am Ende standen +3,85 % .
Diese Zahl wirkt technisch, ist aber für alle Fachgruppen relevant – sie bedeutet z.B., dass eine hausärztliche Leistung, die 2023 mit 10 € vergütet wurde, 2024 rund 10,39 € bringt. In Anbetracht von Inflationsraten in ähnlicher Größenordnung bedeutet dies kaum Reallohngewinn. Die KBV selbst bezeichnete das Ergebnis als unbefriedigend, die Ärzteschaft protestierte mit Praxisschließungen und Demonstrationen.
Für 2025 zeichnet sich eine ähnlich harte Verhandlungsrunde ab. Immerhin: Das Problembewusstsein wächst. Die Politik erwägt langfristige Lösungen, z.B. den Orientierungswert automatisch an Kostentrends zu koppeln, um zukünftig solche Auseinandersetzungen zu entschärfen. Ob dies kommt, bleibt abzuwarten.
GOÄ und Privatliquidation
Auf der privaten Seite arbeiten viele Ärztinnen und Ärzte noch mit der veralteten Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) von 1996. Seit fast 30 Jahren wurden die GOÄ-Grundsätze nicht mehr umfassend reformiert – ein erhebliches Ärgernis, da medizinischer Fortschritt und Inflation unberücksichtigt blieben. Zwar können Ärzte den Steigerungsfaktor (bis 3,5-fach) nutzen und Analogziffern für neue Leistungen, doch eine zeitgemäße GOÄ fehlt.
2025 könnte hier ein Wendepunkt sein: Ein konsentierter GOÄ-Neuentwurf steht beim Deutschen Ärztetag zur Abstimmung . Würde dieser umgesetzt, könnten private Leistungen ggf. höher bewertet werden, was insbesondere Fachärzten mit hohem Privatanteil (z.B. Augenärzte, Dermatologen, HNO) zugutekäme. Bislang jedoch bleiben die Privatumsätze in vielen Praxen hinter den Erwartungen – auch weil die Zahl der Privatversicherten leicht sinkt und viele Patienten kostenbewusster agieren.
Dennoch: Der Privatpatientenanteil ist weiterhin ein entscheidender Faktor für hohe Einnahmen. Beispielsweise finanzieren Privatpatienten in einer durchschnittlichen Hausarztpraxis etwa 9 % der Einnahmen , in einer HNO-Praxis oder Dermatologie können es 20–30 % sein. Sollte die GOÄ-Novelle kommen, dürften gerade gut situierte Praxen in Ballungsräumen profitieren. Umgekehrt würde ein Scheitern der Reform bedeuten, dass Ärzte weiter mit der Unzulänglichkeit der alten GOÄ leben müssen.
Personalengpässe und Arbeitszeit
Ein weniger quantitativer, aber wichtiger Aspekt: der Fachkräftemangel. Immer mehr Praxen finden kaum genug MFA oder med. Fachpersonal. Dies begrenzt die Leistungsfähigkeit der Praxis und damit indirekt das Honorar. Einige Ärztinnen und Ärzte reduzieren mangels Personal sogar Sprechstunden. Zugleich wünschen sich viele Ärzte selbst eine bessere Work-Life-Balance – Überstunden und Bürokratie (z.B. Dokumentation, Abrechnung) nagen an der Wirtschaftlichkeit, da sie unproduktive Zeit binden.
Hier setzen Hoffnungen in Digitalisierung und KI an, um Abläufe effizienter zu machen. Erste Studien zeigen, dass KI-Assistenzsysteme in der Praxis Verwaltungsaufwand senken könnten und somit pro Jahr mehrere zehntausend Euro einsparen könnten . Ob dies Realität wird, bleibt abzuwarten, doch es verdeutlicht: Produktivität und Honorar hängen eng zusammen. Wenn es gelingt, mehr Zeit für die Patientenversorgung freizuschaufeln (etwa durch Entlastung bei Dokumentation), könnten Praxen auch wieder mehr Fälle abrechnen – was letztlich allen zugutekommt.
Zusammenfassend stehen die Honorare niedergelassener Ärzte in Deutschland derzeit unter dem Druck externer Faktoren. Inflation und Personalkosten fressen einen Teil der nominalen Zuwächse auf; gleichzeitig wird an den Stellschrauben EBM und GOÄ gedreht, um die Vergütungssysteme anzupassen. Es ist ein Balanceakt zwischen Kostendämpfung auf Kassenseite und attraktiven Einnahmen für die Praxisärzte. Die Jahre 2023–2025 sind in dieser Hinsicht eine wichtige Phase, die vermutlich darüber entscheidet, ob die Niederlassung für junge Ärztinnen und Ärzte attraktiv bleibt oder ob sich der Trend zur Anstellung verstärkt.
Fazit und Ausblick
Der Finanzskalpell Ärzte Honorar Report 2025 zeigt ein differenziertes Bild: Während deutsche Ärztinnen und Ärzte im internationalen Vergleich nach wie vor zur Spitzenverdienerschaft gehören, haben sich die Rahmenbedingungen deutlich verschärft. Viele Praxisinhaber/innen verzeichneten 2022/23 real sinkende Einkommen trotz voller Wartenzimmer – ein frustrierender Befund, der sich in Umfragen widerspiegelt (nur ein Drittel ist mit dem eigenen Gehalt zufrieden) . Dennoch gibt es Lichtblicke: Die Politik hat erste Schritte unternommen (Entbudgetierung Pädiatrie, Berücksichtigung MFA-Kosten, GOÄ-Reform in Arbeit), und die Gesamtvergütungen steigen zumindest moderat weiter. Für 2025 wird ein Honorarplus von knapp 4 % erwartet, was hoffentlich durch niedrigere Inflation wirksamer bei den Praxen ankommt.
Was bedeutet das für die Praxis?
Ärzte, die bereits niedergelassen sind, sollten ihre betriebswirtschaftlichen Zahlen genau im Auge behalten, Kosteneinsparpotenziale prüfen (ohne die Versorgungsqualität zu gefährden) und ggf. verstärkt auf Privatleistungen setzen, wo medizinisch und ethisch vertretbar. Praxisinhaber, die stark unzufrieden sind, sollten ihre Situation mit Kollegen vergleichen – liegt es am Fachgebiet, am Standort oder an ineffizienten Abläufen? Manchmal kann eine Praxisberatung helfen, die Ertragslage zu verbessern.
Für angehende Ärztinnen und Ärzte bleibt die Niederlassung trotz aller Hürden eine attraktive Option, gerade langfristig. Die Verdienstchancen in eigener Praxis übersteigen auf Dauer die eines Angestellten deutlich. Allerdings muss man bereit sein, unternehmerisch zu denken und anfänglich zu investieren. Wichtig ist, realistische Erwartungen zu haben: Der „typische“ niedergelassene Facharzt erwirtschaftet vielleicht 15.000–20.000 € im Monat vor Steuern, nicht die vielfach kolportierten 30.000 € und mehr – solche Summen erreichen nur bestimmte Spitzenpraxen. Mit 150.000–250.000 € Jahresüberschuss lässt sich jedoch sehr gut leben und vorsorgen, und viele Ärzte schätzen die Freiheiten der Selbständigkeit trotz aller Bürokratie.
Ausblick
Die kommenden Jahre werden zeigen, ob die Trendwende gelingt. Gelingt es, die ambulante Versorgung finanziell zu stärken (Stichwort ambulant vor stationär, aber bitte mit entsprechender Honorierung), könnten wieder mehr junge Mediziner den Schritt in die Praxis wagen. Bleiben die Honorare hingegen real auf der Stelle, droht eine Welle von Praxisabgaben ohne Nachfolger – mit fatalen Folgen für die Patientenversorgung. Gerade in Zeiten des Ärztemangels muss die Niederlassung attraktiv bleiben. Das bedeutet nicht nur angemessenes Honorar, sondern auch Entlastung von Bürokratie und Unterstützung beim Praxismanagement.
Die Zeichen stehen auf Veränderung: 2025 könnte mit der GOÄ-Novelle und möglicherweise weiteren Reformen (Krankenhausreform, Digitalisierungsschub) ein Wendepunkt werden. Ärztinnen und Ärzte tun gut daran, informiert zu bleiben, sich ggf. berufs- oder standespolitisch einzubringen und betriebswirtschaftlich vorausschauend zu handeln. Dieser Honorar-Report soll dazu beitragen, ein klareres Bild der aktuellen Lage zu vermitteln. Trotz mancher Widrigkeiten gilt ein positiver Schlussakzent: Die überwältigende Mehrheit der Ärzte würde laut Umfragen wieder denselben Beruf ergreifen. Die Leidenschaft für Medizin und Patient*innen ist ungebrochen – und mit vereinten Kräften lässt sich hoffentlich auch erreichen, dass sich diese Leidenschaft (weiterhin) wirtschaftlich lohnt.
Quellen: Die Daten und Fakten in diesem Artikel stammen aus aktuellen Berichten und Statistiken, u.a. KBV-Honorarberichte , Zi-Praxis-Panel Jahresbericht 2023 sowie Veröffentlichungen von Ärzteverbänden und Fachpresse (Ärztezeitung, Medical Tribune). Alle Zahlen beziehen sich – sofern nicht anders angegeben – auf Deutschland und auf die Jahre 2022 bis 2025. Die Tabellen und Abbildungen wurden auf Basis dieser Quellen erstellt, um einen schnellen Überblick zu ermöglichen. Obwohl mit höchster Sorgfalt recherchiert, können individuelle Praxissituationen abweichen – dieser Report bietet eine Orientierung.
Neueste Artikel
Newsletter und kostenloses E-Book
Jede Woche neue Therapieansätze für deine finanzielle Gesundheit.